Donnerstag, 20. Mai 2010
Die Niederlage Berlins
19.05.2010: Die Niederlage Berlins (Tageszeitung junge Welt)
Hintergrund. Die 750 Milliarden Euro umfassende Garantieerklärung vom 9. Mai hilft zwar den Banken, rettet aber die Währungsunion nicht vor dem Untergang
Von Lucas Zeise
Der 9. Mai 2010 markiert eine krachende Niederlage des deutschen Kapitals. Die Europastrategie der deutschen Bundesregierungen seit Helmut Kohl ist an der Griechenland-, Staatsfinanzen- und Euro-Krise auf Grund gelaufen. An diesem Sonntag, dem 9.Mai– eigentlich war es in der späten Nachtsitzung schon der Montag geworden –, beschlossen die Finanzminister der EU in Brüssel ein grandioses staatliches Rettungspaket für Euro-Staaten im Umfang von insgesamt 750 Milliarden Euro.
Dieser Beschluß widerspricht diametral allem, was deutsche neoliberal und gleichzeitig erzkonservativ gesonnene Ökonomen, Rechtsgelehrte und Politiker in Deutschland seit den Maastricht-Verträgen zur Schaffung der Euro-Währungsunion für richtig, gut und erforderlich gehalten haben. Daß es sich hier um eine deftige Niederlage handelt, kann man unter anderem an den ungewohnt kritischen Kommentaren der regierungstreuen Presse an Kanzlerin Angela Merkel erkennen. Die Berichte, wie das in Brüssel beschlossene Riesenrettungspaket erst den Ministern und Fraktionsvorsitzenden, dann den Abgeordneten im Bundestag schmackhaft gemacht werden soll, sind einfach verblüffend. Niemand scheint zu wissen, was da passiert und was beschlossen wird.
Ein Glück, werden der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Volker Kauder, und Frau Merkel sich denken, daß unsere Leute so zahm sind und nur in nebensächlichen Fragen manchmal aufmucken. Unseren Experten glauben sie alles. Also wird, wie nur kurz zuvor das ungenügende, kleine Griechenland-Paket, im Eiltempo ein neues, allein für den deutschen Staatshaushalt mehr als 120 Milliarden Euro ausmachendes Garantiepaket durchs Parlament gewunken. Alle eisernen Prinzipien, wonach denjenigen Staaten, die Schulden machen, niemals und nimmer geholfen werden darf, diese Schuldenbösewichte vielmehr bestraft werden müssen, sind jetzt vergessen. Plötzlich ist das Gegenteil richtig. Die Bösewichte sind nun die Spekulanten. Sie greifen die armen Schulden machenden Staaten an. Diesen neuen Bösewichten muß nunmehr gezeigt werden, wo der Hammer hängt. Damit sie erschrecken, erklärt man ihnen, daß für alle Schulden irgendwelcher Euro-Länder immer und überall die Bundesrepublik Deutschland einsteht.
Dieser neuen Version der Geschichte glauben nun unsere Abgeordneten. Sie kuschen vor der Kanzlerin, die auf offener Bühne mit ihrer Politik gescheitert ist. Das ist wahre Treue.
Das Angenehme am Euro
Worin bestand die Europastrategie des deutschen Kapitals und seiner Bundesregierungen? Ein schöner, expandierender Binnenmarkt direkt vor der Haustür mußte her. Dazu ist eine gemeinsame Währung recht angenehm. Sie verstetigt, um nicht zu sagen, befördert die heimische Exportwirtschaft. Die Schaffung dieser einheitlichen Währung war ein schwieriger und von Widersprüchen gekennzeichneter Prozeß. Seitdem die US-Regierung das System fester Wechselkurse in den frühen 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgekündigt hatte, stellten sich die gegeneinander schwankenden Währungen als ökonomisches Entwicklungshindernis in der Welt, besonders aber im kleinteiligen Europa dar. Der frei und zeitweise wild schwankende Dollarkurs führte in Europa regelmäßig zu Währungskrisen und notwendigen Anpassungen der Wechselkurse. Das bremste das Wachstum, behinderte den Handel, vertiefte die Konjunkturkrisen und schmälerte die Gewinne. Die Schaffung eines zollfreien Binnenmarktes in der EU und ihren Anrainerstaaten fand ihre Krönung in der Währungsunion.
Das Projekt »Gemeinsame Währung« wurde von den deutschen Unternehmen, vor allem den dominierenden auf den Export ausgerichteten Unternehmen und allen Bundesregierungen seit Helmut Schmidt aktiv vorangetrieben. Man kann es auch anders ausdrücken: Die Hauptnutznießer des Euro sind die deutschen Unternehmen, schon deshalb, weil sie in Euro-Land die meisten Waren absetzen. Diese Bemerkung sollte eigentlich eine Binsenwahrheit sein. Sie ist es aber nicht. Denn es hält sich seit Helmut Kohls Zeiten die Mär, seine deutsche Bundesregierung habe die D-Mark auf Wunsch des damaligen französischen Premiers François Mitterrand auf dem Altar der bilateralen Freundschaft geopfert. Und um des Friedens in Europa willen habe er dem Euro zugestimmt, pflegte mit sentimental-selbstgefälligem Augenklappern Bundeskanzler Kohl zu sagen. Das ist ein Märchen. Es unterschlägt das massive Interesse des deutschen Kapitals an der Währungsunion.
Allerdings gab es Opposition zur Aufgabe der D-Mark. Sie kam von deutschnationaler Seite und, was meist dasselbe ist, von jenen, die fürchteten, die über Jahrzehnte erworbene Vorherrschaft der strikt restriktiv ausgerichteten Bundesbank über das Geld in Europa könne verlorengehen. Mit restriktiver Zinspolitik hatte der deutsche Kapitalismus die führende Rolle in Europa errungen. Restriktive Politik hieß und heißt heute ebenso, Wachstumsverluste in Kauf zu nehmen, um niedrige Arbeits- und Sozialkosten zu erhalten. Diese Politik wurde nur in der Phase der Übernahme der DDR aufgegeben. Ansonsten wurde sie durchgehalten.
Bezogen auf die Konstruktion der Währungsunion heißt das: Der Markt mit einheitlicher Währung hat zwar hohe Priorität für die deutschen Unternehmen und die Regierung. Aber diese Art Absatzförderung darf nichts kosten. Mögen andere Länder Schulden machen, damit der Markt auch aufnahmebereit ist. Die Schuldenlast aber müssen sie allein tragen. Keinesfalls auch darf der fröhliche Absatz und dürfen die grandios steigenden Gewinne unserer lieben, heimischen Unternehmen beim heimischen Publikum oder gar dem Arbeitnehmer ankommen. Um das zu erreichen, wird in Deutschland weiterhin eine restriktive Wirtschaftspolitik verfolgt. Wenn anderswo anders verfahren wird, ist das zwar schön für den Absatz deutscher Unternehmen, zugleich aber sündhaft. Deutschland wird dafür nicht zahlen.
Logik des Geschäftslebens
Dieser Standpunkt hat die Logik des allgemeinen Geschäftslebens für sich. So geht man schließlich immer und überall mit Konkurrenten um. Auch deshalb ist diese Haltung beim deutschen Publikum populär. Der Standpunkt setzte sich bei der Konstruktion des Euro in den Maastricht-Verträgen durch und fand Eingang in den Lissabon-Vertrag. Vereinbart wurde, daß die am Euro teilnehmenden Länder ihre Staatsschuld strikt begrenzen sollten; die jährliche Neuverschuldung darf nicht über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und die akkumulierten Schulden dürfen nicht über 60 Prozent des BIP ausmachen. Zweitens sollte kein Staat für die Schulden eines anderen haften. Aus dieser Bestimmung wurde, als die Griechenland-Krise voranschritt, in der deutschen Presse sogar das Verbot, Hilfskredit zu gewähren. Aus dem Haftungsausschluß wurde ein Haftungsverbot. Drittens sollte die Notenbank EZB von jeglichen staatlichen Weisungen unabhängig sein. Viertens, und man kann hinzufügen: verrücktestens, setzte sich die deutsche Regierung mit dem Postulat durch, daß in der gemeinsamen Währungsunion keine gemeinsame oder wenigstens koordinierte Wirtschaftspolitik stattfinden dürfe.
Ökonomisch kann diese Strategie nicht funktionieren. Und es zeigte sich, daß sie nicht funktioniert. Die Verschuldung der Staaten richtete sich nicht nach den oben genannten Maastricht-Kriterien. Ironischerweise war es – abgesehen vom Sonderfall Griechenland – als erste die deutsche Regierung, die mit dem aufs Sparen versessenen Finanzminister Hans Eichel den Stabilitätspakt deutlich verletzte. Die Konjunkturkrise (und die Steuergeschenke an die Unternehmer) hatten die Einnahmen einbrechen lassen. Die Folge war eine unbedeutende Umformulierung der Schuldenregeln, die etwas mehr Ausnahmen zuließ. Folgenreicher war es, daß die Euro-Länder sich ökonomisch unterschiedlich entwickelten, ohne daß die Wirtschaftspolitik gegensteuerte. In Deutschland sorgten die staatlich betriebene Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zusammen mit zahmen Gewerkschaften für stagnierende Reallöhne und niedrige Lohnkosten der Unternehmen. Nur in den Niederlanden war die Entwicklung ähnlich. Dies führte dazu, daß die Konsumnachfrage in diesen Ländern ebenfalls stagnierte. In den anderen Euro-Ländern führten etwas stärker steigende Löhne zu höherer Nachfrage, einem stärkeren Wachstum des Binnenmarktes. Die Folge war, daß der Export aus Deutschland und den Niederlanden in die übrigen Länder stetig zunahm, während umgekehrt deren Exporte nach Deutschland schrumpften.
Staatsstütze nur für deutsche Banken
Ein Euro-Europa der ungleichen Entwicklung hätte durchaus noch einige Jahre als eine von Deutschland dominierte Quasiidylle fortbestehen können. Wie man allerdings am so glücklich vereinigten Deutschland selbst feststellen kann, funktioniert ein Land mit einer Währung, in der der Ostteil vorwiegend Markt ist, während der Westteil vorwiegend dorthin exportiert, nur (und auch dann noch schlecht), wenn staatliche Transferleistungen das sich deindustrialisierende Marktgebiet knapp über Wasser halten. Der Idylle bereitete die Finanzkrise ein Ende. Die Bundesregierung war im Herbst 2008 besonders schnell, als es darum ging, die Banken zu retten und diese Staatsstütze trotz gemeinsamer Euro-Währung nur auf die eigenen deutschen zu beschränken. Sie war auch erfolgreich bemüht, dafür einen besonders hohen Betrag zu mobilisieren (immerhin 480 Milliarden Euro), um dem Finanzmarkt, der auch damals die Welt schlechthin bedeutete, zu signalisieren, welche fiskalische Garantiemacht und Wucht die Geschäfte der deutschen Banken unterstützt. Der elende Standortwettbewerb wurde nun vornehmlich auf dem Gebiet der Staatsfinanzen bzw. der Frage ausgefochten, wer am meisten Steuergeld mobilisieren kann. Jedenfalls setzte die Stützungsaktion der Privatbanken durch ihre jeweiligen Staatshaushalte dem Frieden in der Euro-Zone ein Ende. Überall schnellten die Schulden der Staaten nach oben, weil die Steuern in der Krise schrumpften, während die Ausgaben für die Banken und die Konjunkturprogramme wuchsen.
Als die gepäppelten Banken, Versicherungen und Fonds im Spätherbst vorigen Jahres nicht nur an der Kreditwürdigkeit des deutschen Mittelstandes zweifelten, sondern auch an der Zahlungsfähigkeit des griechischen Staates, reagierten Berlin und Brüssel zunächst damit, der griechischen Regierung harte Auflagen zu machen. Sie sollte das fehlende Geld bei ihrem Volk eintreiben. Später fanden sich Berlin und Brüssel bereit, einen Hilfskredit zu unterschreiben, aber nur zu wucherartigen Zinssätzen, die dem Land schier gar nichts halfen. Schritt für Schritt lernte die Bundesregierung immer ein wenig zu spät, daß die Währungsunion scheitern würde, wenn sie an der alten Strategie festhält. So kam es schließlich zum größtmöglichen Betrag, der unter Einschluß der vom Internationalen Währungsfonds bereitgestellten Mittel satte 750 Milliarden Euro bereitstellt und die Schulden aller Euro-Länder mit schwachen Staatsfinanzen garantieren soll. (Ob das ausreicht, ist allerdings noch offen.) Zugleich hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die Stimmen des niederländischen und der beiden deutschen Vertreter beschlossen, die Staatsanleihen der Euro-Länder zu kaufen oder anders ausgedrückt, die Geldschöpfung zur Finanzierung der Staatshaushalte zu verwenden.
Das Resultat ist also das genaue Gegenteil dessen, was die Bundesregierung beabsichtigte. Warum hat sie sich schließlich gebeugt? Die anderen Handlungsoptionen wären aus ihrer Sicht noch schlimmer gewesen. Eine hätte darin bestanden, hart zu bleiben, keine Kreditgarantien an die schwächeren Länder zu geben. Damit wäre die Währungsunion zerplatzt, vielleicht sogar die EU selbst. Das Geschäftsmodell, ein aufnahmebereiter Binnenmarkt vor der Haustür, wäre damit zerstoben. Die zweite Option hätte darin bestanden, den schwächeren Staaten Griechenland, Portugal, vielleicht auch Spanien, Irland, Italien und Belgien eine kontrollierte Entwertung ihrer Staatsschulden zu gewähren und dies wohlwollend zu begleiten. Wenn ein Land sich einseitig für zahlungsunfähig erklärt, hat es kurzfristig ein erhebliches Finanzierungsproblem. Importe können nicht bezahlt werden. Wie man am Fall Argentinien 2001/2002 sehen kann, überstehen Regierungen derartige Krisen meist nicht. Alternativ hätten die noch kreditwürdigen Euro-Staaten eine Zwischenfinanzierung bereitstellen können, um eine sogenannte Umschuldung durchzuziehen. Am Finanzmarkt wurde diese Lösung als durchaus realistische Option gehandelt. (Man fragt sich allerdings, ob die Organe der EU, Kommission und Ministerrat, überhaupt zu solchen Beschlüssen fähig wären, die ja komplizierte Verhandlungen voraussetzen und die Märkte möglichst überrumpeln sollten.) Der »Nachteil« dieser Lösung bestand aus der Sicht der Bundesregierung und mindestens ebenso der französischen Regierung darin, daß es die heimischen Banken und Versicherungen erheblich belastet hätte. Der Wertverlust der Kredite und Anleihen hätte einige Banken überfordert. Da die Regierungsgarantien für die Banken ja bereits bestehen, bedurfte es gar nicht der dezenten Hinweise von Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann und anderen, um die politische Führung von der Umschuldungslösung Abstand nehmen zu lassen.
Ungleichgewichte vergrößern sich
Wie geht es weiter? Leider spricht nichts dafür, daß es zu einer rationalen Neukonzeption der Währungsunion kommt. Die deutsche Regierung hat zwar eine Schlacht verloren. Den Sieg der anderen Seite kann sie aber verhindern. Worin bestünde ein solcher Sieg? Es würde zu einem Versuch kommen, eine gemeinsame, koordinierte Wirtschaftspolitik im Euro-Raum zu betreiben. Einige Regierungen in dieser Region haben durchaus Interesse daran. Ein solcher Schritt würde die politische Union der Euro-Länder vorantreiben. Konkret würde es sich als ein gewaltiges politisches Palaver und Gefeilsche über die Richtung der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedsländern des Euro darstellen. Danach erhielte dann etwa die deutsche (und die niederländische) Regierung den Auftrag, den Verbrauchermarkt anzukurbeln, für eine egalitärere Einkommensverteilung und für ebensolche Bildungschancen zu sorgen sowie eine Anhebung der Unternehmenssteuern vorzunehmen. Griechenland würde verdonnert, zur Sanierung des Staatshaushalts die Steuerbasis zu verbreitern und den Einkauf von Rüstungsgütern drastisch einzuschränken. Schließlich würden die Euro-Staaten ein Programm zur Schrumpfung des Finanzsektors auflegen.
Natürlich ist das zu schön, um jemals wahr zu werden. Die Bundesregierung wird darauf beharren, daß die EU-Kommission gemeinsam mit dem IWF das Heft in Griechenland in die Hand nimmt und eine Art Generalgouvernement dort ausübt. (Weil der IWF die nötige Expertise beim Druckmachen auf verschuldete Staaten hat, hat Frau Merkel darauf bestanden, ihn gegen den Rat der EZB in die Griechenlandrettungs- und -unterwerfungsaktion mit einzubeziehen. Ein weiterer Grund war, daß den Griechen die Möglichkeit genommen werden sollte, sich angesichts der extrem harten, von Frau Merkel durchgesetzten Konditionen, an den IWF als alternativen Retter zu wenden.) Zugleich wird sie darauf beharren, daß sie selbst nie und nimmer auch nur mit der höflichen Aufforderung konfrontiert werden wird, eine expansivere Wirtschaftspolitik zu betreiben.
Die Freude über die Niederlage der Berliner Regierung muß sich also in Grenzen halten. Es wird sich nichts wirklich bessern. Wenn sich nichts bessert, kann auch die Krise des Euro-Raums nicht gelöst werden. Die Ungleichgewichte werden sich eher noch verschärfen. Also wird die Währungsunion scheitern.
In einem Punkt sind sich rechte und linke, konservative und keynesianische Beobachter einig: Der 750-Milliarden-Euro-Deal vertagt das Problem, aber er löst es nicht. Er ist die Fortsetzung der Bankenrettung vom Herbst 2008 – aber an etwas anderer Stelle. Das Problem an diesem Deal ist nicht, daß die EZB nun Staatsanleihen kauft und daß danach die Inflation kommt. Solche Bedenken sind albern. Das Gelddrucken hat die EZB betrieben, als der Boom in voller Blüte war. Als der Crash 2007 endlich da war, hat sie den Banken unbegrenzt Liquidität gegen gute und schlechte Sicherheiten zur Verfügung gestellt. Man sollte sie nicht tadeln deswegen. Das war und ist ihr Job. Wenn sie jetzt Staatsanleihen kauft, setzt sie nur das fort, was sie bisher getan hat. Potentiell inflationär war die Politik der Notenbank auch bisher schon. Dennoch hat das viele von ihr gemachte Geld zur Herstellung von Inflation nicht ausgereicht. Es gilt nach wie vor der einfache Satz: So lange das viele Geld in den Händen der Begüterten und deren Kapitalsammelstellen bleibt und dort zirkuliert, entstehen höchstens eine Inflation der Vermögenspreise und Spekulationsblasen.
Schädliche Konsequenzen
Der 750-Milliarden-Euro-Deal hat zwei ausgesprochen schädliche Konsequenzen. Zum einen verhindert er nicht, daß es in den Südländern der Euro-Zone zu einem harten Schwenk in Richtung restriktiver Politik kommt. Das wird die Nachfrage und das Wachstum zusätzlich dämpfen – ganz abgesehen von den verheerenden sozialen Folgen. Zum zweiten werden erneut die Finanzinstitutionen verschont. Der Finanzsektor bleibt fett und aufgeblasen. Die Staatsbudgets werden bis zum äußersten ausgeweitet, um Banken, Versicherungen und Fonds zu stützen. Die halbherzigen Versuche, über Boniabschöpfung oder Bankenabgabe einen Teil dieser Ausgaben hereinzuholen, werden zu nichts führen. Auch die nun von der SPD als Forderung adaptierte Transaktions-, Spekulations-, Börsenumsatz- oder auch Tobin-Steuer wäre, wenn sie denn tatsächlich beschlossen würde, eine ziemlich harmlose Maßnahme. Nichts gegen ihre Einführung. Nur soll man keine Wunder erwarten. Die Finanzgeschäfte werden damit kaum nennenswert erschwert werden.
Noch ein Wort zur These, die bisherige unter deutscher Führung befindliche Euro-Zone unterwerfe sich durch den großen Schulden-Garantie-Deal und weil der von Washington dominierte IWF mit von der Partie ist, stärker als zuvor der US-Führung. Eine solche Interpretation setzt die Akzente nicht korrekt. Schließlich ist die Beteiligung des IWF von Berlin aus betrieben worden, um die Knebelung Griechenlands besser organisieren zu können. Richtig ist, daß die USA vor allem ein Interesse daran hatten, daß die Euro-Staaten keine Umschuldung zu Lasten der internationalen Finanzkonzerne vornehmen. Nicht etwa weil US-Banken besonders betroffen wären, sondern vor allem, weil der erste Staat, der seine Schulden streicht, einen Vorteil hat. Dieses Vorrecht gebührt, so findet Washington, natürlich dem Dollar-Raum. Man erinnere sich an 1971, als der damalige US-Präsident Richard Nixon entschied, entgegen den internationalen Verträgen von Bretton Woods, keine Unze Gold mehr für den dargebotenen Dollar herauszurücken. Diese milde Form der Staatspleite, vulgo Zahlungsunfähigkeitserklärung, hat die Welt damals massiv umgekrempelt. Herrschernationen gehen anders pleite als Griechenland oder Argentinien.
Außerdem dürfte Barack Obama in seinen Telefongesprächen mit Merkel und dem französischen Amtskollegen Nicolas Sarkozy darauf hingewiesen haben, daß eine einseitige Zahlungsunfähigkeitserklärung, Umschuldung oder Pleite der Euro-Länder zu einer ähnlichen Reaktion der USA führen würde. Wir wären dann mitten im Abwertungswettlauf, der in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts so verheerend gewirkt hat und der bisher in dieser Weltwirtschaftskrise vermieden wurde.
Lucas Zeise ist Finanzkolumnist der Financial Times Deutschland. Außer in der jungen Welt schreibt er regelmäßig in den Marxistischen Blättern und in Lunapark 21. Im Herbst erscheint bei PapyRossa sein neues Buch »Geld – Der vertrackte Kern des Kapitalismus. Ein Versuch über die politische Ökonomie des Finanzsektors«
Hintergrund. Die 750 Milliarden Euro umfassende Garantieerklärung vom 9. Mai hilft zwar den Banken, rettet aber die Währungsunion nicht vor dem Untergang
Von Lucas Zeise
Der 9. Mai 2010 markiert eine krachende Niederlage des deutschen Kapitals. Die Europastrategie der deutschen Bundesregierungen seit Helmut Kohl ist an der Griechenland-, Staatsfinanzen- und Euro-Krise auf Grund gelaufen. An diesem Sonntag, dem 9.Mai– eigentlich war es in der späten Nachtsitzung schon der Montag geworden –, beschlossen die Finanzminister der EU in Brüssel ein grandioses staatliches Rettungspaket für Euro-Staaten im Umfang von insgesamt 750 Milliarden Euro.
Dieser Beschluß widerspricht diametral allem, was deutsche neoliberal und gleichzeitig erzkonservativ gesonnene Ökonomen, Rechtsgelehrte und Politiker in Deutschland seit den Maastricht-Verträgen zur Schaffung der Euro-Währungsunion für richtig, gut und erforderlich gehalten haben. Daß es sich hier um eine deftige Niederlage handelt, kann man unter anderem an den ungewohnt kritischen Kommentaren der regierungstreuen Presse an Kanzlerin Angela Merkel erkennen. Die Berichte, wie das in Brüssel beschlossene Riesenrettungspaket erst den Ministern und Fraktionsvorsitzenden, dann den Abgeordneten im Bundestag schmackhaft gemacht werden soll, sind einfach verblüffend. Niemand scheint zu wissen, was da passiert und was beschlossen wird.
Ein Glück, werden der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Volker Kauder, und Frau Merkel sich denken, daß unsere Leute so zahm sind und nur in nebensächlichen Fragen manchmal aufmucken. Unseren Experten glauben sie alles. Also wird, wie nur kurz zuvor das ungenügende, kleine Griechenland-Paket, im Eiltempo ein neues, allein für den deutschen Staatshaushalt mehr als 120 Milliarden Euro ausmachendes Garantiepaket durchs Parlament gewunken. Alle eisernen Prinzipien, wonach denjenigen Staaten, die Schulden machen, niemals und nimmer geholfen werden darf, diese Schuldenbösewichte vielmehr bestraft werden müssen, sind jetzt vergessen. Plötzlich ist das Gegenteil richtig. Die Bösewichte sind nun die Spekulanten. Sie greifen die armen Schulden machenden Staaten an. Diesen neuen Bösewichten muß nunmehr gezeigt werden, wo der Hammer hängt. Damit sie erschrecken, erklärt man ihnen, daß für alle Schulden irgendwelcher Euro-Länder immer und überall die Bundesrepublik Deutschland einsteht.
Dieser neuen Version der Geschichte glauben nun unsere Abgeordneten. Sie kuschen vor der Kanzlerin, die auf offener Bühne mit ihrer Politik gescheitert ist. Das ist wahre Treue.
Das Angenehme am Euro
Worin bestand die Europastrategie des deutschen Kapitals und seiner Bundesregierungen? Ein schöner, expandierender Binnenmarkt direkt vor der Haustür mußte her. Dazu ist eine gemeinsame Währung recht angenehm. Sie verstetigt, um nicht zu sagen, befördert die heimische Exportwirtschaft. Die Schaffung dieser einheitlichen Währung war ein schwieriger und von Widersprüchen gekennzeichneter Prozeß. Seitdem die US-Regierung das System fester Wechselkurse in den frühen 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgekündigt hatte, stellten sich die gegeneinander schwankenden Währungen als ökonomisches Entwicklungshindernis in der Welt, besonders aber im kleinteiligen Europa dar. Der frei und zeitweise wild schwankende Dollarkurs führte in Europa regelmäßig zu Währungskrisen und notwendigen Anpassungen der Wechselkurse. Das bremste das Wachstum, behinderte den Handel, vertiefte die Konjunkturkrisen und schmälerte die Gewinne. Die Schaffung eines zollfreien Binnenmarktes in der EU und ihren Anrainerstaaten fand ihre Krönung in der Währungsunion.
Das Projekt »Gemeinsame Währung« wurde von den deutschen Unternehmen, vor allem den dominierenden auf den Export ausgerichteten Unternehmen und allen Bundesregierungen seit Helmut Schmidt aktiv vorangetrieben. Man kann es auch anders ausdrücken: Die Hauptnutznießer des Euro sind die deutschen Unternehmen, schon deshalb, weil sie in Euro-Land die meisten Waren absetzen. Diese Bemerkung sollte eigentlich eine Binsenwahrheit sein. Sie ist es aber nicht. Denn es hält sich seit Helmut Kohls Zeiten die Mär, seine deutsche Bundesregierung habe die D-Mark auf Wunsch des damaligen französischen Premiers François Mitterrand auf dem Altar der bilateralen Freundschaft geopfert. Und um des Friedens in Europa willen habe er dem Euro zugestimmt, pflegte mit sentimental-selbstgefälligem Augenklappern Bundeskanzler Kohl zu sagen. Das ist ein Märchen. Es unterschlägt das massive Interesse des deutschen Kapitals an der Währungsunion.
Allerdings gab es Opposition zur Aufgabe der D-Mark. Sie kam von deutschnationaler Seite und, was meist dasselbe ist, von jenen, die fürchteten, die über Jahrzehnte erworbene Vorherrschaft der strikt restriktiv ausgerichteten Bundesbank über das Geld in Europa könne verlorengehen. Mit restriktiver Zinspolitik hatte der deutsche Kapitalismus die führende Rolle in Europa errungen. Restriktive Politik hieß und heißt heute ebenso, Wachstumsverluste in Kauf zu nehmen, um niedrige Arbeits- und Sozialkosten zu erhalten. Diese Politik wurde nur in der Phase der Übernahme der DDR aufgegeben. Ansonsten wurde sie durchgehalten.
Bezogen auf die Konstruktion der Währungsunion heißt das: Der Markt mit einheitlicher Währung hat zwar hohe Priorität für die deutschen Unternehmen und die Regierung. Aber diese Art Absatzförderung darf nichts kosten. Mögen andere Länder Schulden machen, damit der Markt auch aufnahmebereit ist. Die Schuldenlast aber müssen sie allein tragen. Keinesfalls auch darf der fröhliche Absatz und dürfen die grandios steigenden Gewinne unserer lieben, heimischen Unternehmen beim heimischen Publikum oder gar dem Arbeitnehmer ankommen. Um das zu erreichen, wird in Deutschland weiterhin eine restriktive Wirtschaftspolitik verfolgt. Wenn anderswo anders verfahren wird, ist das zwar schön für den Absatz deutscher Unternehmen, zugleich aber sündhaft. Deutschland wird dafür nicht zahlen.
Logik des Geschäftslebens
Dieser Standpunkt hat die Logik des allgemeinen Geschäftslebens für sich. So geht man schließlich immer und überall mit Konkurrenten um. Auch deshalb ist diese Haltung beim deutschen Publikum populär. Der Standpunkt setzte sich bei der Konstruktion des Euro in den Maastricht-Verträgen durch und fand Eingang in den Lissabon-Vertrag. Vereinbart wurde, daß die am Euro teilnehmenden Länder ihre Staatsschuld strikt begrenzen sollten; die jährliche Neuverschuldung darf nicht über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und die akkumulierten Schulden dürfen nicht über 60 Prozent des BIP ausmachen. Zweitens sollte kein Staat für die Schulden eines anderen haften. Aus dieser Bestimmung wurde, als die Griechenland-Krise voranschritt, in der deutschen Presse sogar das Verbot, Hilfskredit zu gewähren. Aus dem Haftungsausschluß wurde ein Haftungsverbot. Drittens sollte die Notenbank EZB von jeglichen staatlichen Weisungen unabhängig sein. Viertens, und man kann hinzufügen: verrücktestens, setzte sich die deutsche Regierung mit dem Postulat durch, daß in der gemeinsamen Währungsunion keine gemeinsame oder wenigstens koordinierte Wirtschaftspolitik stattfinden dürfe.
Ökonomisch kann diese Strategie nicht funktionieren. Und es zeigte sich, daß sie nicht funktioniert. Die Verschuldung der Staaten richtete sich nicht nach den oben genannten Maastricht-Kriterien. Ironischerweise war es – abgesehen vom Sonderfall Griechenland – als erste die deutsche Regierung, die mit dem aufs Sparen versessenen Finanzminister Hans Eichel den Stabilitätspakt deutlich verletzte. Die Konjunkturkrise (und die Steuergeschenke an die Unternehmer) hatten die Einnahmen einbrechen lassen. Die Folge war eine unbedeutende Umformulierung der Schuldenregeln, die etwas mehr Ausnahmen zuließ. Folgenreicher war es, daß die Euro-Länder sich ökonomisch unterschiedlich entwickelten, ohne daß die Wirtschaftspolitik gegensteuerte. In Deutschland sorgten die staatlich betriebene Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zusammen mit zahmen Gewerkschaften für stagnierende Reallöhne und niedrige Lohnkosten der Unternehmen. Nur in den Niederlanden war die Entwicklung ähnlich. Dies führte dazu, daß die Konsumnachfrage in diesen Ländern ebenfalls stagnierte. In den anderen Euro-Ländern führten etwas stärker steigende Löhne zu höherer Nachfrage, einem stärkeren Wachstum des Binnenmarktes. Die Folge war, daß der Export aus Deutschland und den Niederlanden in die übrigen Länder stetig zunahm, während umgekehrt deren Exporte nach Deutschland schrumpften.
Staatsstütze nur für deutsche Banken
Ein Euro-Europa der ungleichen Entwicklung hätte durchaus noch einige Jahre als eine von Deutschland dominierte Quasiidylle fortbestehen können. Wie man allerdings am so glücklich vereinigten Deutschland selbst feststellen kann, funktioniert ein Land mit einer Währung, in der der Ostteil vorwiegend Markt ist, während der Westteil vorwiegend dorthin exportiert, nur (und auch dann noch schlecht), wenn staatliche Transferleistungen das sich deindustrialisierende Marktgebiet knapp über Wasser halten. Der Idylle bereitete die Finanzkrise ein Ende. Die Bundesregierung war im Herbst 2008 besonders schnell, als es darum ging, die Banken zu retten und diese Staatsstütze trotz gemeinsamer Euro-Währung nur auf die eigenen deutschen zu beschränken. Sie war auch erfolgreich bemüht, dafür einen besonders hohen Betrag zu mobilisieren (immerhin 480 Milliarden Euro), um dem Finanzmarkt, der auch damals die Welt schlechthin bedeutete, zu signalisieren, welche fiskalische Garantiemacht und Wucht die Geschäfte der deutschen Banken unterstützt. Der elende Standortwettbewerb wurde nun vornehmlich auf dem Gebiet der Staatsfinanzen bzw. der Frage ausgefochten, wer am meisten Steuergeld mobilisieren kann. Jedenfalls setzte die Stützungsaktion der Privatbanken durch ihre jeweiligen Staatshaushalte dem Frieden in der Euro-Zone ein Ende. Überall schnellten die Schulden der Staaten nach oben, weil die Steuern in der Krise schrumpften, während die Ausgaben für die Banken und die Konjunkturprogramme wuchsen.
Als die gepäppelten Banken, Versicherungen und Fonds im Spätherbst vorigen Jahres nicht nur an der Kreditwürdigkeit des deutschen Mittelstandes zweifelten, sondern auch an der Zahlungsfähigkeit des griechischen Staates, reagierten Berlin und Brüssel zunächst damit, der griechischen Regierung harte Auflagen zu machen. Sie sollte das fehlende Geld bei ihrem Volk eintreiben. Später fanden sich Berlin und Brüssel bereit, einen Hilfskredit zu unterschreiben, aber nur zu wucherartigen Zinssätzen, die dem Land schier gar nichts halfen. Schritt für Schritt lernte die Bundesregierung immer ein wenig zu spät, daß die Währungsunion scheitern würde, wenn sie an der alten Strategie festhält. So kam es schließlich zum größtmöglichen Betrag, der unter Einschluß der vom Internationalen Währungsfonds bereitgestellten Mittel satte 750 Milliarden Euro bereitstellt und die Schulden aller Euro-Länder mit schwachen Staatsfinanzen garantieren soll. (Ob das ausreicht, ist allerdings noch offen.) Zugleich hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die Stimmen des niederländischen und der beiden deutschen Vertreter beschlossen, die Staatsanleihen der Euro-Länder zu kaufen oder anders ausgedrückt, die Geldschöpfung zur Finanzierung der Staatshaushalte zu verwenden.
Das Resultat ist also das genaue Gegenteil dessen, was die Bundesregierung beabsichtigte. Warum hat sie sich schließlich gebeugt? Die anderen Handlungsoptionen wären aus ihrer Sicht noch schlimmer gewesen. Eine hätte darin bestanden, hart zu bleiben, keine Kreditgarantien an die schwächeren Länder zu geben. Damit wäre die Währungsunion zerplatzt, vielleicht sogar die EU selbst. Das Geschäftsmodell, ein aufnahmebereiter Binnenmarkt vor der Haustür, wäre damit zerstoben. Die zweite Option hätte darin bestanden, den schwächeren Staaten Griechenland, Portugal, vielleicht auch Spanien, Irland, Italien und Belgien eine kontrollierte Entwertung ihrer Staatsschulden zu gewähren und dies wohlwollend zu begleiten. Wenn ein Land sich einseitig für zahlungsunfähig erklärt, hat es kurzfristig ein erhebliches Finanzierungsproblem. Importe können nicht bezahlt werden. Wie man am Fall Argentinien 2001/2002 sehen kann, überstehen Regierungen derartige Krisen meist nicht. Alternativ hätten die noch kreditwürdigen Euro-Staaten eine Zwischenfinanzierung bereitstellen können, um eine sogenannte Umschuldung durchzuziehen. Am Finanzmarkt wurde diese Lösung als durchaus realistische Option gehandelt. (Man fragt sich allerdings, ob die Organe der EU, Kommission und Ministerrat, überhaupt zu solchen Beschlüssen fähig wären, die ja komplizierte Verhandlungen voraussetzen und die Märkte möglichst überrumpeln sollten.) Der »Nachteil« dieser Lösung bestand aus der Sicht der Bundesregierung und mindestens ebenso der französischen Regierung darin, daß es die heimischen Banken und Versicherungen erheblich belastet hätte. Der Wertverlust der Kredite und Anleihen hätte einige Banken überfordert. Da die Regierungsgarantien für die Banken ja bereits bestehen, bedurfte es gar nicht der dezenten Hinweise von Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann und anderen, um die politische Führung von der Umschuldungslösung Abstand nehmen zu lassen.
Ungleichgewichte vergrößern sich
Wie geht es weiter? Leider spricht nichts dafür, daß es zu einer rationalen Neukonzeption der Währungsunion kommt. Die deutsche Regierung hat zwar eine Schlacht verloren. Den Sieg der anderen Seite kann sie aber verhindern. Worin bestünde ein solcher Sieg? Es würde zu einem Versuch kommen, eine gemeinsame, koordinierte Wirtschaftspolitik im Euro-Raum zu betreiben. Einige Regierungen in dieser Region haben durchaus Interesse daran. Ein solcher Schritt würde die politische Union der Euro-Länder vorantreiben. Konkret würde es sich als ein gewaltiges politisches Palaver und Gefeilsche über die Richtung der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedsländern des Euro darstellen. Danach erhielte dann etwa die deutsche (und die niederländische) Regierung den Auftrag, den Verbrauchermarkt anzukurbeln, für eine egalitärere Einkommensverteilung und für ebensolche Bildungschancen zu sorgen sowie eine Anhebung der Unternehmenssteuern vorzunehmen. Griechenland würde verdonnert, zur Sanierung des Staatshaushalts die Steuerbasis zu verbreitern und den Einkauf von Rüstungsgütern drastisch einzuschränken. Schließlich würden die Euro-Staaten ein Programm zur Schrumpfung des Finanzsektors auflegen.
Natürlich ist das zu schön, um jemals wahr zu werden. Die Bundesregierung wird darauf beharren, daß die EU-Kommission gemeinsam mit dem IWF das Heft in Griechenland in die Hand nimmt und eine Art Generalgouvernement dort ausübt. (Weil der IWF die nötige Expertise beim Druckmachen auf verschuldete Staaten hat, hat Frau Merkel darauf bestanden, ihn gegen den Rat der EZB in die Griechenlandrettungs- und -unterwerfungsaktion mit einzubeziehen. Ein weiterer Grund war, daß den Griechen die Möglichkeit genommen werden sollte, sich angesichts der extrem harten, von Frau Merkel durchgesetzten Konditionen, an den IWF als alternativen Retter zu wenden.) Zugleich wird sie darauf beharren, daß sie selbst nie und nimmer auch nur mit der höflichen Aufforderung konfrontiert werden wird, eine expansivere Wirtschaftspolitik zu betreiben.
Die Freude über die Niederlage der Berliner Regierung muß sich also in Grenzen halten. Es wird sich nichts wirklich bessern. Wenn sich nichts bessert, kann auch die Krise des Euro-Raums nicht gelöst werden. Die Ungleichgewichte werden sich eher noch verschärfen. Also wird die Währungsunion scheitern.
In einem Punkt sind sich rechte und linke, konservative und keynesianische Beobachter einig: Der 750-Milliarden-Euro-Deal vertagt das Problem, aber er löst es nicht. Er ist die Fortsetzung der Bankenrettung vom Herbst 2008 – aber an etwas anderer Stelle. Das Problem an diesem Deal ist nicht, daß die EZB nun Staatsanleihen kauft und daß danach die Inflation kommt. Solche Bedenken sind albern. Das Gelddrucken hat die EZB betrieben, als der Boom in voller Blüte war. Als der Crash 2007 endlich da war, hat sie den Banken unbegrenzt Liquidität gegen gute und schlechte Sicherheiten zur Verfügung gestellt. Man sollte sie nicht tadeln deswegen. Das war und ist ihr Job. Wenn sie jetzt Staatsanleihen kauft, setzt sie nur das fort, was sie bisher getan hat. Potentiell inflationär war die Politik der Notenbank auch bisher schon. Dennoch hat das viele von ihr gemachte Geld zur Herstellung von Inflation nicht ausgereicht. Es gilt nach wie vor der einfache Satz: So lange das viele Geld in den Händen der Begüterten und deren Kapitalsammelstellen bleibt und dort zirkuliert, entstehen höchstens eine Inflation der Vermögenspreise und Spekulationsblasen.
Schädliche Konsequenzen
Der 750-Milliarden-Euro-Deal hat zwei ausgesprochen schädliche Konsequenzen. Zum einen verhindert er nicht, daß es in den Südländern der Euro-Zone zu einem harten Schwenk in Richtung restriktiver Politik kommt. Das wird die Nachfrage und das Wachstum zusätzlich dämpfen – ganz abgesehen von den verheerenden sozialen Folgen. Zum zweiten werden erneut die Finanzinstitutionen verschont. Der Finanzsektor bleibt fett und aufgeblasen. Die Staatsbudgets werden bis zum äußersten ausgeweitet, um Banken, Versicherungen und Fonds zu stützen. Die halbherzigen Versuche, über Boniabschöpfung oder Bankenabgabe einen Teil dieser Ausgaben hereinzuholen, werden zu nichts führen. Auch die nun von der SPD als Forderung adaptierte Transaktions-, Spekulations-, Börsenumsatz- oder auch Tobin-Steuer wäre, wenn sie denn tatsächlich beschlossen würde, eine ziemlich harmlose Maßnahme. Nichts gegen ihre Einführung. Nur soll man keine Wunder erwarten. Die Finanzgeschäfte werden damit kaum nennenswert erschwert werden.
Noch ein Wort zur These, die bisherige unter deutscher Führung befindliche Euro-Zone unterwerfe sich durch den großen Schulden-Garantie-Deal und weil der von Washington dominierte IWF mit von der Partie ist, stärker als zuvor der US-Führung. Eine solche Interpretation setzt die Akzente nicht korrekt. Schließlich ist die Beteiligung des IWF von Berlin aus betrieben worden, um die Knebelung Griechenlands besser organisieren zu können. Richtig ist, daß die USA vor allem ein Interesse daran hatten, daß die Euro-Staaten keine Umschuldung zu Lasten der internationalen Finanzkonzerne vornehmen. Nicht etwa weil US-Banken besonders betroffen wären, sondern vor allem, weil der erste Staat, der seine Schulden streicht, einen Vorteil hat. Dieses Vorrecht gebührt, so findet Washington, natürlich dem Dollar-Raum. Man erinnere sich an 1971, als der damalige US-Präsident Richard Nixon entschied, entgegen den internationalen Verträgen von Bretton Woods, keine Unze Gold mehr für den dargebotenen Dollar herauszurücken. Diese milde Form der Staatspleite, vulgo Zahlungsunfähigkeitserklärung, hat die Welt damals massiv umgekrempelt. Herrschernationen gehen anders pleite als Griechenland oder Argentinien.
Außerdem dürfte Barack Obama in seinen Telefongesprächen mit Merkel und dem französischen Amtskollegen Nicolas Sarkozy darauf hingewiesen haben, daß eine einseitige Zahlungsunfähigkeitserklärung, Umschuldung oder Pleite der Euro-Länder zu einer ähnlichen Reaktion der USA führen würde. Wir wären dann mitten im Abwertungswettlauf, der in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts so verheerend gewirkt hat und der bisher in dieser Weltwirtschaftskrise vermieden wurde.
Lucas Zeise ist Finanzkolumnist der Financial Times Deutschland. Außer in der jungen Welt schreibt er regelmäßig in den Marxistischen Blättern und in Lunapark 21. Im Herbst erscheint bei PapyRossa sein neues Buch »Geld – Der vertrackte Kern des Kapitalismus. Ein Versuch über die politische Ökonomie des Finanzsektors«
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

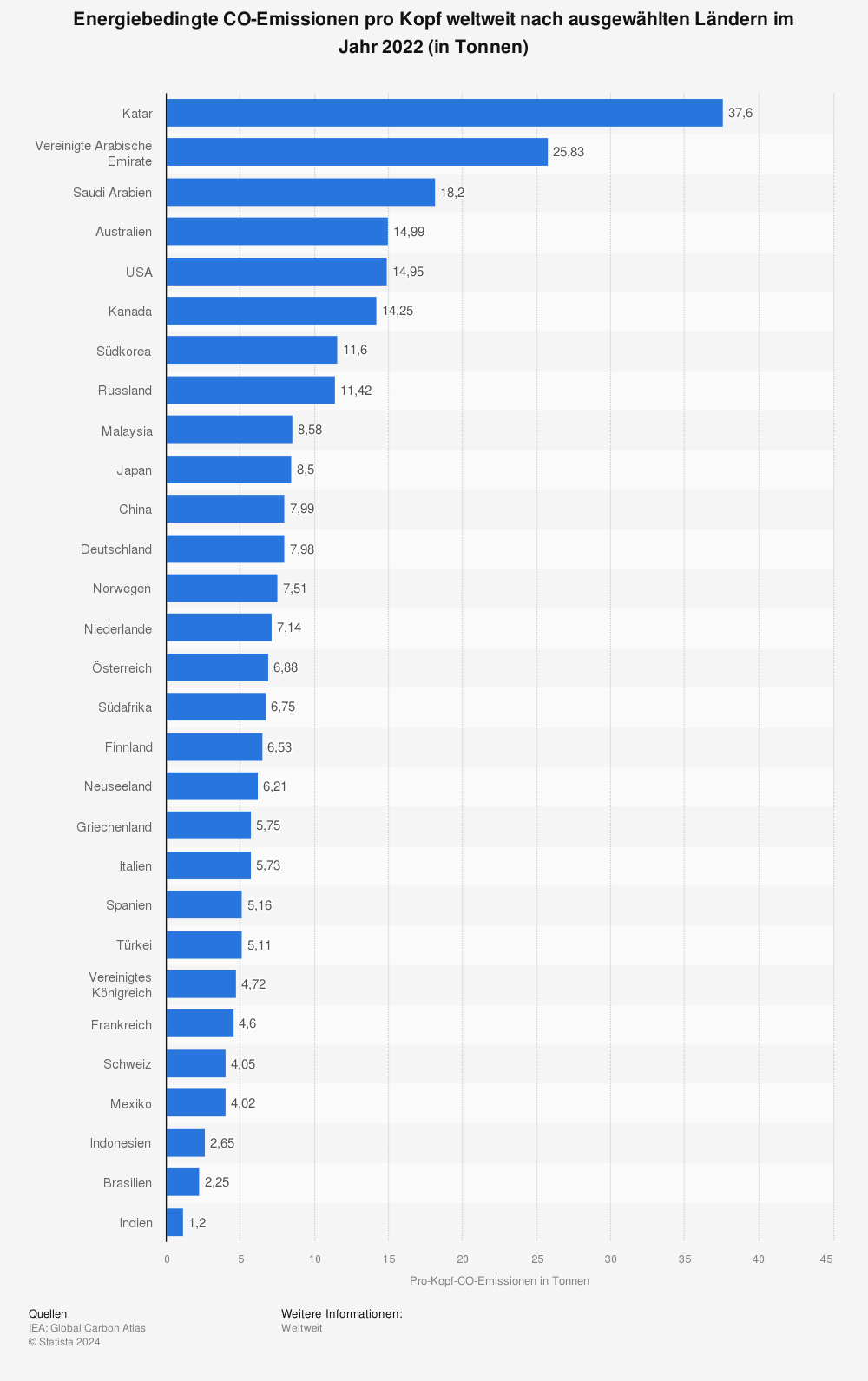





Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen