Im April besuchten US-Finanzministerin Janet Yellen, BRD-Kanzler Olaf Scholz und US-Außenminister Antony Blinken nacheinander China. Yellen monierte angebliche „Überkapazitäten“. Mit Staatsförderung könnten chinesische Firmen Solarmodule, Elektro-Autos und Lithium-Ionen-Batterien billig herstellen und den Weltmarkt überschwemmen. Ein weiteres Thema Yellens war die globale Finanzstabilität. Sie erfordere im Krisenfall koordiniertes Handeln, genauso wie, so Yellen, „Militärführer eine Hotline benötigen.“
Zur selben Zeit nahm im US-Wahlkampf die Kampagne gegen die
TikTok App Fahrt auf. Abgeordnete beider großen Parteien beschimpften u. a. die
Protestbewegung „Free Palestine“ als eine über TikTok-Algorithmen gesteuerte „Einmischung
der KP Chinas“. Wie Trump 2020, beschloss der Kongress erneut, TikTok vor die
Alternative „US-Eigentum oder Verbot“ zu stellen. Ob es um Trumps Strangulierung
von Huawei und ZTE oder Bidens Lieferverbot für Halbleiter geht – gegen China
ist das Duopol auf einer Wellenlänge, wie bei Nordstream.
Neben der Bestrafung der „Überkapazitäten“ wollen die USA „Sekundärsanktionen“
gegen Drittstaaten, welche die illegalen Anti-Russland-Sanktionen ignorieren. Beides
diskutiert auch die EU-Spitze. Von beidem wäre China betroffen. Beides sind Vorwände, China Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Das Basteln der EU-Kommission
an Strafzöllen gegen Elektroautos aus China missfiel allerdings den deutschen
Autokonzernen. „Die Geschichte lehrt uns, dass Protektionismus nicht zu
langfristigem Erfolg führt,“ sagte Mercedes-Chef Källenius dem Managermagazin (12.3.2024).
Der Verband der Autoindustrie (VDA) forderte "beidseitige
Dialogbereitschaft" statt Zölle. Ein Handelskonflikt gefährde Arbeitsplätze
und die Transformation hin zu Elektromobilität und Digitalisierung (Zeit.de
13.4.2024).
Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig handeln“ stand der Scholz-Besuch
in China. Mit ihm reisten die Chefs von Siemens, Mercedes, Bayer und BMW. Während
die EU-Kommission zu Strafzöllen ausholte, demonstrierten Scholz und die großen
deutschen Konzerne ihr Interesse an Kontinuität in ökonomischer Kooperation und
Koexistenz mit China. Die chinesische Zeitung „Global Times“ würdigte das
überschwänglich: „Vor dem Hintergrund eskalierender regionaler Konflikte und
Spannungsherde, wie auch einer unsicheren globalen Erholung und wachsendem
Gegenwind des Handelsprotektionismus, trug dieses Spitzentreffen beider Länder zu
seltener Stabilität und Zuversicht in der Welt bei“ (16.4.2024).
Dann fuhr Blinken nach Peking. Zu Beginn schien er unschlüssig,
welches „Vergehen“ Chinas sich für den US-Wahlkampf und für Sanktionen am besten
eignet. Abwechselnd thematisierte er Yellens „Überkapazitäten“, die
Menschenrechte in Xinjiang, Chinas Nichtbeachtung der Russlandsanktionen, Taiwan.
Nach dem Treffen mit Xi tat er kund, er habe Xi klar gemacht, Lieferungen für Russlands
industrielle Basis stärkten die russische Verteidigungskraft und bedrohten nicht
nur die Sicherheit der Ukraine, sondern die ganz Europas. Blinken: „Ich machte
klar, wenn China das Problem nicht angeht, werden wir das tun“ (AP 26.4.2024).
Kooperation in Eurasien kann es in der US-geführten
unipolaren Weltordnung, in der Neocon Blinken sich wähnt, nicht geben. Zur US-Dominanz
gehört der Keil zwischen einem „transatlantischen Westeuropa“ und Russland/China.
Davon profitierte mit der EU- und NATO-Ostexpansion auch der deutsche
Imperialismus. Blinken hält nun Scholz und der deutschen Autoindustrie vor
Augen: Sanktionen gegen China kommen so und so. Ihr werdet Euch entscheiden
müssen! Vorerst aber besucht Xi Frankreich, Ungarn und Serbien. „Xi auf Mission,
einen Keil zwischen US und Europa zu treiben,“ lautet prompt eine Überschrift bei
Bloomberg (29.4.2024). Die spiegelverkehrte Version der Ostlandritter.
Die Kolumne von Beate Landefeld erschien zuerst in Unsere Zeit vom 10. Mai 2024

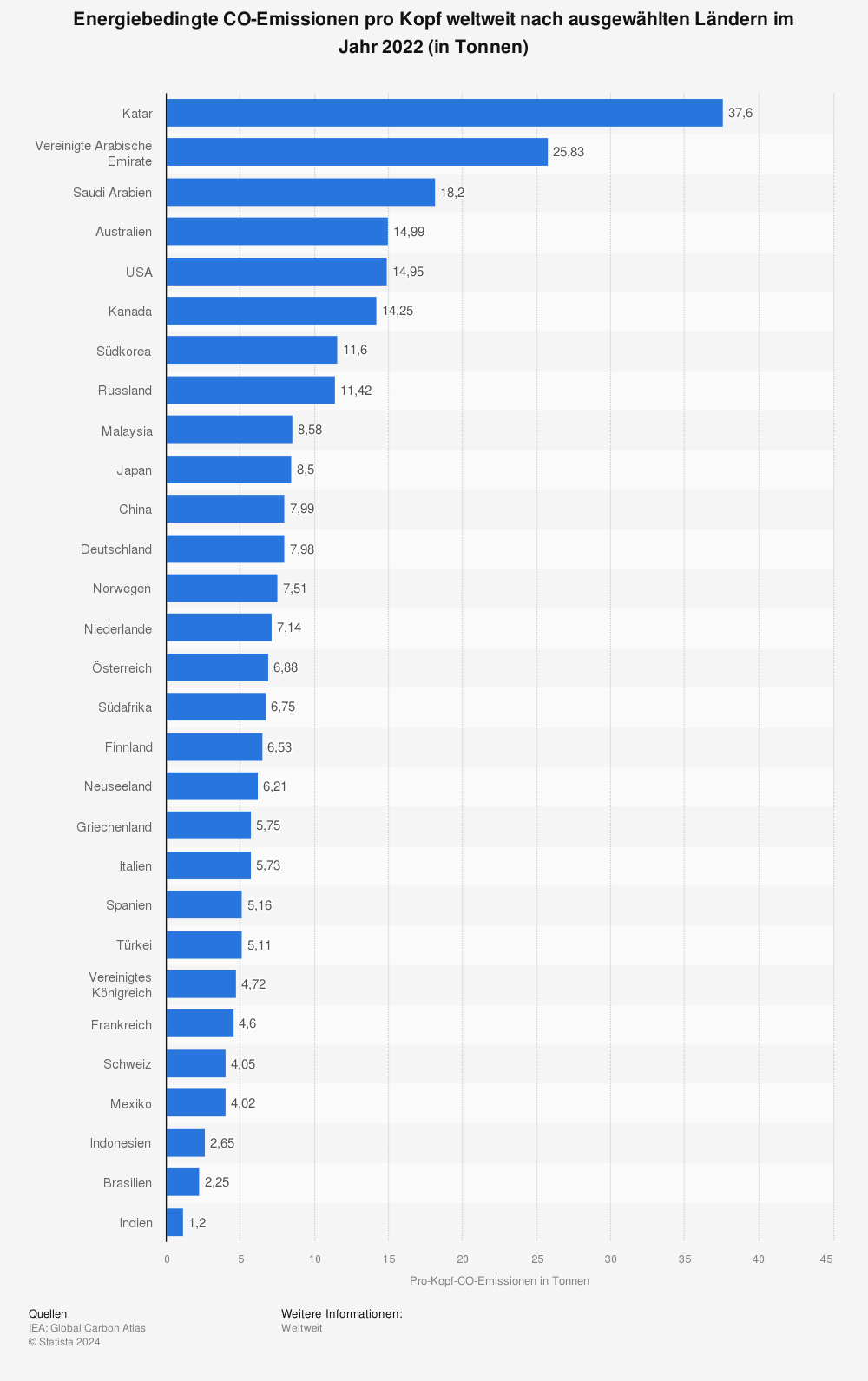





Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen