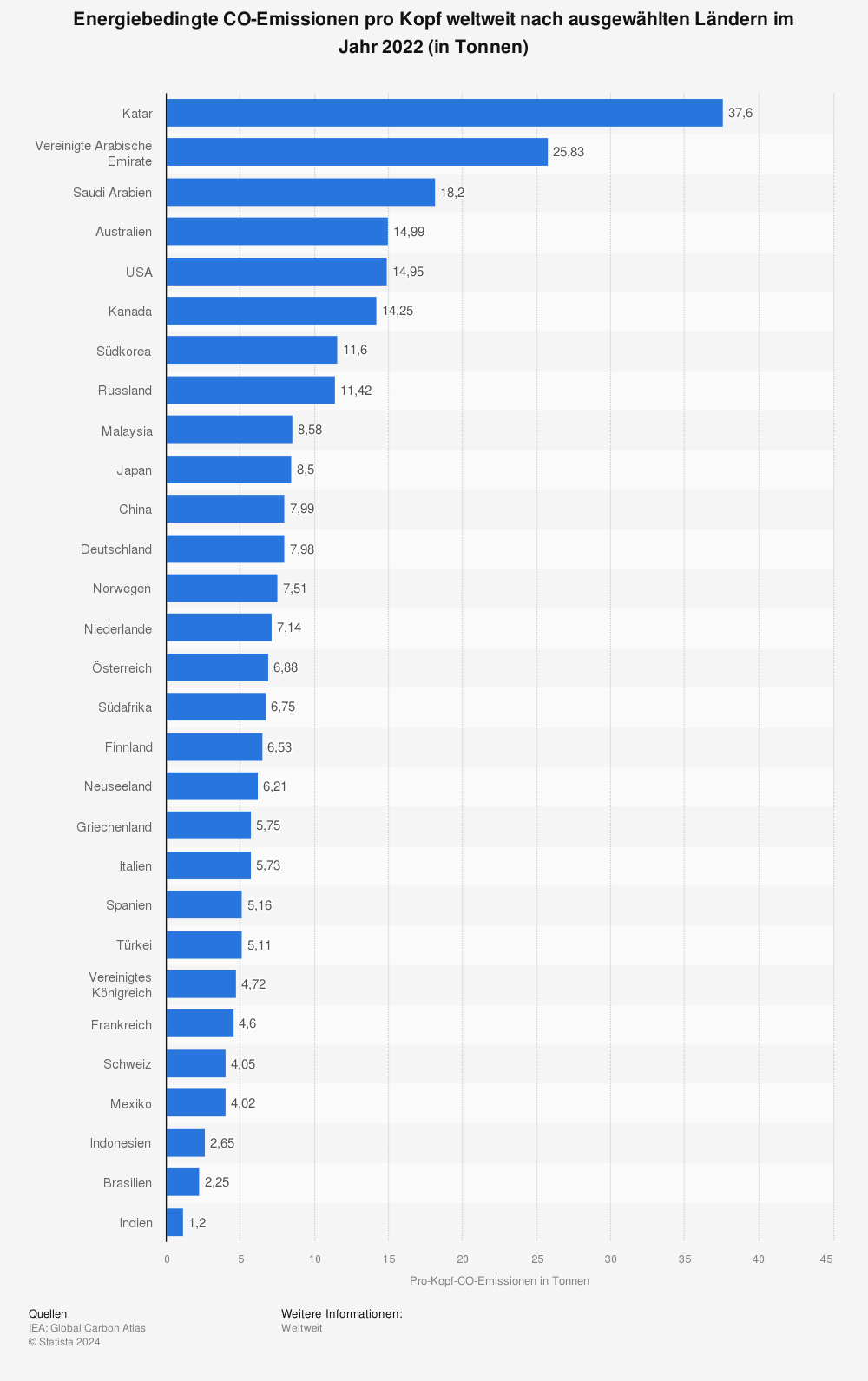„I love the tariffs,“ trällerte Trump im Wahlkampf. Mit zehn Prozent auf Importe aller Länder plus variierenden Aufschlägen für Länder mit Exportüberschüssen gegenüber den USA will er ausgelagerte Produktion „zurückholen“, mit Zolleinnahmen das Staatsbudget aufbessern. Beides wird nicht passieren, sagen fast alle Ökonomen. US-Notenbankchef Jerome Powell prophezeit mehr Inflation, Stagnation, Rezession. Die Konzerne schlagen Zölle auf die Preise wie indirekte Steuern. Abgeschöpft werden die Konsumenten. Rückholung von Produktion braucht Investitionen in Gebäude, Rohstoffe, Maschinen, Arbeitskräfte, in Qualifizierung, Bildung, Gesundheit. Trump lockt mit mehr Deregulierung und Steuersenkungen primär private Investoren.
Verwerfungen in der Weltwirtschaft werden befürchtet. Die Tagesthemen vergleichen Trumps Zollpolitik mit US-Zöllen während der Weltwirtschaftskrise 1930. Yanis Varoufakis sieht Parallelen zu Nixons Beendigung der Golddeckung des Dollars 1971, andere ziehen Vergleiche mit dem „Volcker-Schock“ 1979-82. Die letzten beiden Ereignisse beförderten im Westen die Wende zum Neoliberalismus. Deregulierung, Privatisierung und Umverteilung von unten nach oben sollten die Kapitalprofitabilität erhöhen, nicht zuletzt durch Auslagerungen in „Billiglohnländer“. Harvey definierte den Neoliberalismus als „Restauration von Klassenmacht“.