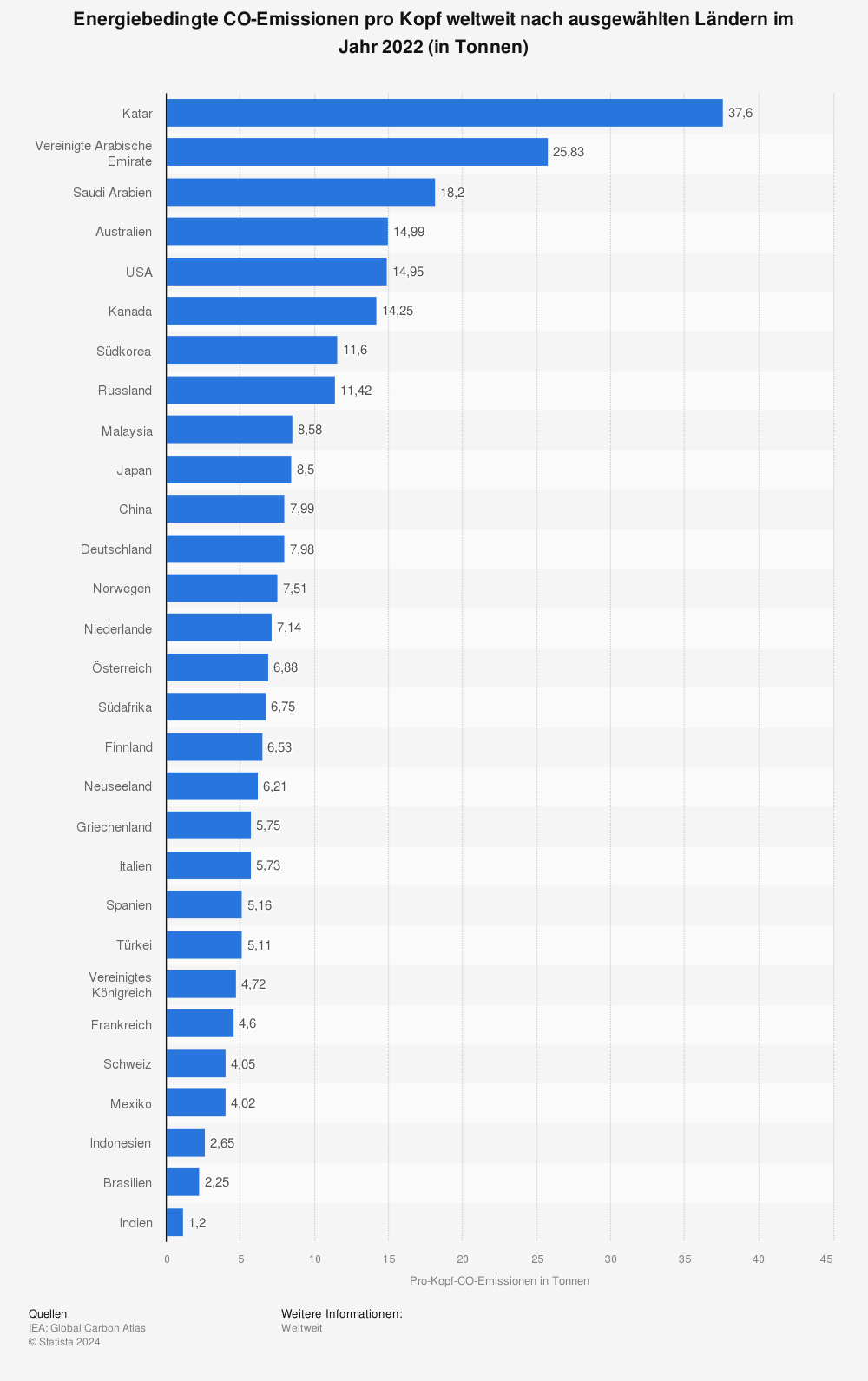26 Prozent derer, die bei der EU-Wahl abstimmten, nannten „Friedenssicherung“ als für ihre Entscheidung wichtigstes Thema. An zweiter Stelle wurde „soziale Sicherheit“ genannt (23 Prozent), gefolgt von „Zuwanderung“ (17 Prozent), „Klima- und Umweltschutz“ (14 Prozent) und „Wirtschaftswachstum“ (13 Prozent). 2019 stand mit 23 Prozent „Klima- und Umweltschutz“ an erster Stelle. Der Ukrainekrieg veränderte die Rangfolge. Im Wahlkampf selbst war „Friedenssicherung“ nur ein Randthema. Politiker der NATO-Parteien von Union, SPD, FDP und Grünen profilierten sich vielmehr als Antreiber beim Besteigen der jeweils nächsten Stufe der Eskalationsleiter.
Mittwoch, 10. Juli 2024
EU-Wahl und Friedensfrage – Erfolge für „Putin-Parteien“?
Freitag, 11. November 2022
Unter „Friendly Fire“ – Scholz reiste nach China
Besorgte Ratschläge, Belehrungen, Warnungen, Schmähungen aus CDU/CSU, grün-gelben Ampelleuchten und den meisten Medien begleiteten Olaf Scholz auf seiner ersten China-Reise als Bundeskanzler. Der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen (CDU), früher für die BRD im UN-Sicherheitsrat, wo er Juan Guaidós Putschversuche gegen Venezuelas Präsidenten Maduro ohne Erfolg unterstützte, war Anfang November auf „Zeitenwende-Tournee“ in den USA. Von dort gab er zum Besten, was die Transatlantiker an der Scholz-Reise alles stört:
„Wenn wir hier in New York mit vielen Kollegen sprechen, da wird man darauf angesprochen, warum zum jetzigen Zeitpunkt, warum zu einem Zeitpunkt, wo in China jetzt ganz klar ist: Da ist ein totalitäres Regime, wir sind zurück zu den Zeiten von Mao Tsetung. Warum geht man jetzt dahin? Warum macht man das mit einer Wirtschaftsdelegation - wo wir gerade ja versuchen, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu vermindern?“ (tagesschau.de 4.11.2022)
Freitag, 14. Januar 2022
EU-Booster für AKWs. Reaktionäre Gefährdung des Atomausstiegs
Die EU-Kommission stuft Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als „klimafreundlich“ ein. Sie gelten damit als „nachhaltig“ und förderungswürdig. Das lenkt Kapitalströme in alte und neue AKWs und zugleich in den „Green New Deal“. Gegen den Plan protestieren Umweltverbände, SPD und Grüne. Die Ampel-Regierung lehnt ihn ab. Beim Thema Gaskraftwerke unterscheidet sich die EU-Position allerdings nicht vom Ampel-Koalitionsvertrag, in dem es realistischerweise heißt: „Wir beschleunigen die Errichtung moderner Gaskraftwerke“, die „für eine Übergangszeit unverzichtbar“ seien. Laut Statistischem Bundesamt ist Erdgas mit einem Anteil von 31 Prozent der mit Abstand wichtigste Energieträger der deutschen Industrie. FDP-Sprecher begrüßten daher die Einstufung als „Erfolg der deutschen Argumente“.
Die Einstufung der Atomkraft als „grün“ ist dagegen ein Erfolg der „französischen Argumente“.
Freitag, 10. September 2021
Die Wahl ist nicht „offen“. Kräfteverhältnis der Klassen entscheidet
Ginge es nur nach der herrschenden Klasse, wäre die Wahl entschieden: Laut Allensbach-Elite-Panel sind 63 Prozent der Spitzenkräfte in Wirtschaft, Politik und Verwaltung für Armin Laschet als nächsten Bundeskanzler. 18 Prozent wollen Olaf Scholz. 7 Prozent wollen Annalena Baerbock. Befragt wurden 501 Führungsspitzen vom 5.-30. Juli. 70 Prozent kamen aus der Wirtschaft, darunter Vorstände von 93 Unternehmen mit mehr als zwanzigtausend Beschäftigten. 21 Prozent kamen aus der Politik und 9 Prozent aus der Verwaltung. Es könnte sich um einen repräsentativen Querschnitt der staatsmonopolistischen Oligarchie gehandelt haben.
Bekanntlich war Laschets Aufstieg zum Kanzlerkandidaten der
Hauptpartei des Monopolkapitals umkämpft. Der Favorit des CDU-Wirtschaftsrats Friedrich
Merz unterlag Laschet bei der Wahl zum CDU-Vorsitz. Gegen Söder als
Kanzlerkandidaten schlugen Merz und der Wirtschaftsrat sich aber auf die Seite
Laschets. Im Gegenzug rief Laschet auf dem jüngsten Jahrestag des
Wirtschaftsrats Merz zum „wirtschafts- und finanzpolitischen Gesicht“ seiner
künftigen Regierung aus. Merkels amtierender Wirtschaftsminister Altmaier blieb
dem Jahrestreffen gleich fern. Zuvor hatte eine aktuelle Mitgliederbefragung im
Wirtschaftsrat mit 82 Prozent der FDP (statt der CDU) ein „gutes oder sehr
gutes Wirtschaftsprofil“ attestiert.
Astrid Hamker, Unternehmerin und Präsidentin des Wirtschaftsrats, urteilt: „Die Wirtschaftskompetenz der Union ist nach zweimal großer Koalition erodiert“. Ähnlich sehen es im Wahljahr die Großspender. Die FDP bekam bis August 3,2 Millionen Euro, die CDU nur 2,8 Millionen. An die Grünen gingen 1,9 Millionen. Mit so viel Vertrauensvorschuss kletterten die Umfragewerte der FDP auf 13 Prozent. Das sichert den Freunden des Großkapitals aus CDU/CSU und/oder FDP die Regierungsbeteiligung in den wahrscheinlichsten Koalitionsvarianten Jamaika oder Ampel.