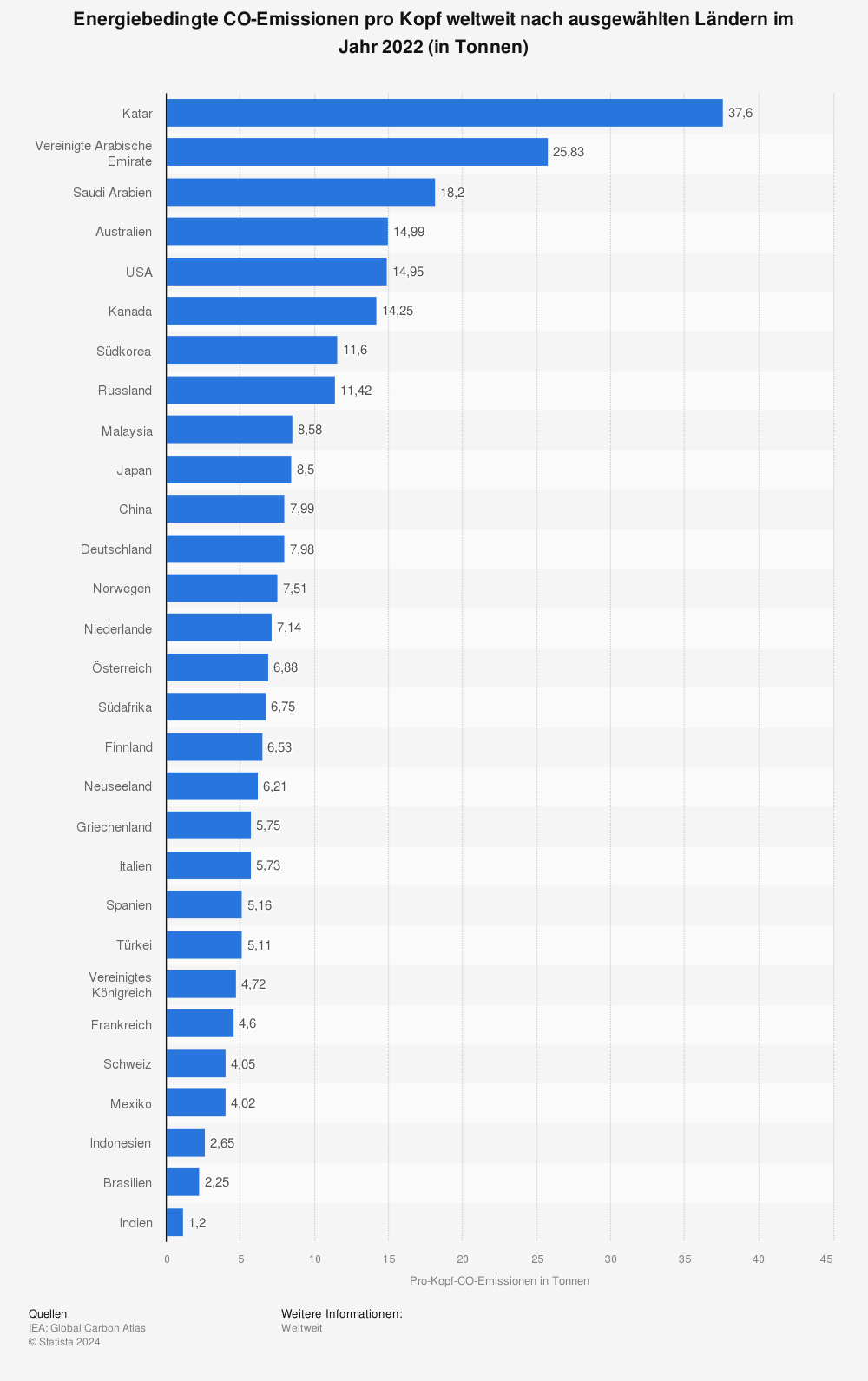Posts mit dem Label DKP-Debatte werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label DKP-Debatte werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Montag, 27. November 2017
Zur Strategie des antimonopolistischen Kampfes
1. Strategie, Taktik und Programm
Was ist eine Strategie? Laut politischem Wörterbuch der DDR bedeutet sie die Bestimmung der Hauptstoßrichtung des revolutionären Kampfes der Arbeiterklasse und die Bestimmung des Verhältnisses der Interessen der Arbeiterklasse zu denen aller anderen sozialen Kräfte in einer bestimmten Periode der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Strategie bestimmt die in einer konkret-historischen Etappe zu lösenden Hauptaufgaben und den Hauptgegner, der der Lösung im Wege steht. Ebenso bestimmt sie die möglichen Hauptverbündeten, die gegen den Gegner mobilisierbar sind, sowie solche sozialen Kräfte, die „paralysiert“ oder „neutralisiert“ werden können. Das Ziel ist, den Hauptgegner zu isolieren und den Kreis der gegen ihn mobilisierbaren Kräfte so stark wie möglich zu machen. Je mehr das gelingt, desto günstiger gestaltet sich der Verlauf des Kampfs um die Hegemonie und um die Macht, desto mehr lassen sich die eigenen Verluste begrenzen.[1]
Was ist eine Strategie? Laut politischem Wörterbuch der DDR bedeutet sie die Bestimmung der Hauptstoßrichtung des revolutionären Kampfes der Arbeiterklasse und die Bestimmung des Verhältnisses der Interessen der Arbeiterklasse zu denen aller anderen sozialen Kräfte in einer bestimmten Periode der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Strategie bestimmt die in einer konkret-historischen Etappe zu lösenden Hauptaufgaben und den Hauptgegner, der der Lösung im Wege steht. Ebenso bestimmt sie die möglichen Hauptverbündeten, die gegen den Gegner mobilisierbar sind, sowie solche sozialen Kräfte, die „paralysiert“ oder „neutralisiert“ werden können. Das Ziel ist, den Hauptgegner zu isolieren und den Kreis der gegen ihn mobilisierbaren Kräfte so stark wie möglich zu machen. Je mehr das gelingt, desto günstiger gestaltet sich der Verlauf des Kampfs um die Hegemonie und um die Macht, desto mehr lassen sich die eigenen Verluste begrenzen.[1]
Montag, 6. Oktober 2014
Lenin zur demokratischen und sozialistischen Etappe der russischen Revolution
Auszüge aus seinen Werken vor und nach der Oktoberrevolution
1. Was tun? 1903 (LW5)
Wir
haben gesagt, dass ein Sozialdemokrat, der nicht nur in Worten für
die Notwendigkeit einer allseitigen Entwicklung des politischen
Bewusstseins des Proletariats eintritt, „in alle Klassen der
Bevölkerung gehen“ muss. Es entstehen die Fragen: Wie ist das zu
machen? Haben wir die Kräfte dazu? Ist der Boden für eine solche
Arbeit in allen übrigen Klassen vorhanden? Wird das nicht eine
Preisgabe des Klassenstandpunkts bedeuten oder zu einer Preisgabe des
Klassenstandpunkts führen? […] Wir
haben weder ein Parlament noch Versammlungsfreiheit, aber wir
verstehen es dennoch, Versammlungen von Arbeitern zu veranstalten,
die einen Sozialdemokraten
hören
wollen. Wir müssen es auch verstehen, Versammlungen von Vertretern
aller Bevölkerungsklassen zu veranstalten, die nur einen Demokraten
hören
wollen.
Samstag, 22. Februar 2014
Meinungsstreit und Handlungseinheit - geht beides?
Beate Landefeld
Eure Einladung
verdanke ich dem Nachdruck meines Artikels zum Thema
„Meinungspluralismus und Kommunistische Partei“ aus den
Marxistischen Blättern 1989. Die darin behandelten Probleme
existieren in modifizierter Form auch heute.
Montag, 27. Mai 2013
Die linke Euro-Diskussion ist in Gang gekommen
In Zypern fordert die größte Oppositionspartei AKEL ein Referendum über den Austritt aus dem Euro. Zuvor hatten die Ökonomen Heiner Flassbeck und Costa Lapavitsas eine Studie für ein Ausstiegsszenario aus dem Euro vorgelegt.
Damit wurde auch in der Linken der BRD eine Diskussion über den Euro ausgelöst, die mit Sicherheit weiter anhalten wird.
Einige Beiträge aus dieser wichtigen Diskussion sollen im folgenden verlinkt werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Damit wurde auch in der Linken der BRD eine Diskussion über den Euro ausgelöst, die mit Sicherheit weiter anhalten wird.
Einige Beiträge aus dieser wichtigen Diskussion sollen im folgenden verlinkt werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Sonntag, 9. Dezember 2012
Zur kommunistischen Parteikonzeption
A) Zunächst einiges zum Zustand der kommunistischen Bewegung:
Es gibt sie noch, punktuell hat sie auch Erfolge, aber insgesamt hat sie sich noch nicht von der historischen Niederlage von 1989 erholt, vor allem in Europa nicht. Auf der einen Seite verzeichnen wir in Südeuropa eine vorwärtstreibende Rolle der KPs: in Griechenland, Spanien, Portugal. Wir konnten einen beeindruckenden 19. Parteitag der PCP am vorigen Wochenende über Internet verfolgen. Ebenso konnten wir in der Woche davor uns über den KPÖ-Wahlerfolg in Graz freuen.Das Verhältnis zwischen der KPÖ-Graz und der KPÖ-Wien spiegelt zugleich die tiefen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der kommunistischen Bewegung, denn ein Anlass für ihr Auseinanderdriften war der Streit um das Verhältnis zur EU und zur EL-Mitgliedschaft der KPÖ. Die Dialektik von Nationalem und Internationalem ist eine von mehreren Fragen, in denen die kommunistische Bewegung noch keine gemeinsamen Antworten gefunden hat. Das gilt vor allem, wenn es darum geht, diese Dialektik auf die konkrete Situation in Europa anzuwenden.
Mittwoch, 18. April 2012
Zur Eliminierung des Parteiprinzips
Brief von Robert Steigerwald
Liebe
Genossen,
der
Genosse Leo Mayer hat einen Aufsatz→
für die KP des Irak geschrieben und diesen der Redaktion der
„Marxistischen Blätter“ und der „UZ“, ihrem Chefredakteur
geschickt. Ich bin dafür, diesen Aufsatz zu veröffentlichen, zumal
er die Substanz der Konzeption Leo Mayers (und jener Genossen, die
ihm dabei folgen) darlegt. Ausführungen Leos zu Gramsci sind nur
der Vordergrund, Hintergrund ist die Diskussion des
Partei-Verständnisses durch Leo Mayer. Es handelt sich m. E. um die
Absage an das Parteiverständnis als eines kommunistischen. Ich bin
also auch der Meinung, dass Leos Aufsatz zusammen (!) mit einer
Kritik an ihm zu veröffentlichen ist.
Die
entscheidenden Passagen in Leos Aufsatz lauten (alle Hervorhebungen
von mir, R. St.):
„Im
Rahmen eines solchen Paradigmas lässt sich auch nicht mehr das
traditionelle, sozialdemokratische, von Lenin im Hinblick auf die
rückständigen Verhältnisse Russlands sogar radikalisierte Bild
einer kommunistischen Partei aufrechterhalten, deren Funktion es sei,
durch Agitation, Propaganda und Organisation einer
unaufgeklärten Masse das sozialistische Bewusstsein 'von außen'(1) (bei)zubringen.
Folgt man dagegen Gramsci,
dann ist es die Funktion der Kommunistischen Partei und der ihr
verbundenen Intellektuellen, zur Organisierung und Systematisierung
eines
in den Massen bereits vorhandenen Wissens
beizutragen, das jedoch ‚eine auseinanderfallende, inkohärente,
inkonsequente Weltauffassung‘ darstelle, ‚der Beschaffenheit der
Volksmengen entsprechend, deren Philosophie‘ sie sei. Eine
homogene, zum gemeinschaftlich solidarischen Handeln befähigende
Weltauffassung einer sozialen Gruppe ist in solcher Sicht nur durch
gleichzeitiges Anknüpfen an den rationalen Elementen der Philosophie
des Alltagsverstandes wie gleichzeitig gegen ihn zu gewinnen.(2)"
Und
wer besorgt dieses Anknüpfen? Der liebe Gott?
Dienstag, 10. April 2012
Wer kontrolliert die DAX-Konzerne?
von Beate Landefeld
Ende 2011
waren 52% der Aktien der Deutschen Bank in Inlandsbesitz, 5% mehr als
2010. Als Ursachen nennt die Bank auf ihrer Homepage „eine aus dem
Ausland nach Deutschland verlagerte Verwahrung von institutionellen
Beständen sowie Aufstockungen von inländischen Privataktionären“
und eine „erstmals seit sechs Jahren wieder höhere Aktienakzeptanz
in Deutschland“ weil Staatsanleihen unsicher würden.i
Fred Schmid nimmt den Anstieg des
Auslandsanteils bei den Aktionären der Deutschen Bank von 2008 bis
2009 zum Anlass, um auszurufen: „Erhöhung bzw. Verringerung um 9
Prozentpunkte binnen eines Jahres, das lässt die Dynamik erahnen.“
Und Conrad Schuhler sekundiert: „Die von Fred Schmid aufgebotenen
empirischen Daten können … nicht bestritten werden. Der
Auslandsanteil bei der Deutschen Bank ist von 2008 bis 2009 von 45%
auf 54% gestiegen.“ii
Beide Autoren verzichten auf eine konkrete Analyse der Ursache dieser
Verschiebung.
Donnerstag, 29. März 2012
Deutsche Bank wieder in "deutscher Hand"
Die Deutsche Bank hat auf ihrer Homepage ihre Aktionärsstruktur zum Ende des Jahres 2011 bekanntgegeben: "Die Zahl unserer Aktionäre erreichte 2011 einen
neuen Höchststand. Sie wuchs im Jahresultimovergleich um 19766 auf 660389 (2010: 640623). Das steht im Einklang mit der erstmals seit sechs
Jahren wieder höheren Aktienakzeptanz in Deutschland.... In Deutschland sind die Bestände an Deutsche
Bank-Aktien um fünf Prozentpunkte auf insgesamt 52% des Grundkapitals gewachsen. Dahinter stehen vor allem eine aus dem Ausland nach
Deutschland verlagerte Verwahrung von institutionellen Beständen sowie
Aufstockungen von inländischen Privataktionären."
Nach der Logik der bürgerlichen Wirtschaftspresse, die seit 2007 die Mehrheit der DAX-Konzerne in "ausländischer Hand" sieht, müßte somit die Deutsche Bank soeben wieder in "deutsche Hand" gefallen sein.
Nach der Logik der bürgerlichen Wirtschaftspresse, die seit 2007 die Mehrheit der DAX-Konzerne in "ausländischer Hand" sieht, müßte somit die Deutsche Bank soeben wieder in "deutsche Hand" gefallen sein.
Dienstag, 27. März 2012
Aktionäre großer Finanzkonzerne 2000-2011 nach Inland:Ausland
Quelle: Geschäftsberichte
| Deutsche Bank | Inland | Ausland |
| 2000 | 48 | 52 |
| 2001 | 47 | 53 |
| 2002 | 54 | 46 |
| 2003 | 47 | 53 |
| 2004 | 49 | 51 |
| 2005 | 52 | 48 |
| 2006 | 54 | 46 |
| 2007 | 54 | 46 |
| 2008 | 55 | 45 |
| 2009 | 46 | 54 |
| 2010 | 47 | 53 |
| 2011 | 52 | 48 |
Sonntag, 4. März 2012
Neue Zahlenspiele des ISW – diesmal von Fred Schmid
In früheren Blogbeiträgen habe ich mich bereits mit der Zahlenakrobatik von Walter Listl beschäftigt. In der UZ vom 2.3.2012 liefert nun Fred Schmid, auch vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung (ISW), ein neuerliches Beispiel für den nicht sehr sorgfältigen Umgang mit empirischem Material, der an den Tag gelegt wird, wenn es darum geht, Kritik an den umstrittenenen Theorien des ISW mit Zahlen zuzuschütten, statt zu widerlegen.
Fred Schmid stellt ein neues ISW-Heft vor. Dabei zeigt er auf, dass in den kapitalistischen Ländern der öffentlichen Verschuldung eine private Reichtumsexplosion gegenüber steht. Er beschreibt dies als ein globales Phänomen. So weit so gut. Leider bemüht er sich dann wieder einmal, eigenständige Interessen, Handlungen und Strategien der deutschen Bourgeoisie, ihrer Konzerne und Banken sowie des Staates als für die heutige Ökonomie nicht mehr „strukturbestimmend“ zu deklarieren, das heißt, sie hinter einer angeblichen Kontrolle der DAX-Unternehmen durch ausländische Investoren verschwinden zu lassen.
Die Dominanz Berlins bei der Unterwerfung der Eurozone unter die „Stabilitätskultur“ des deutschen exportabhängigen Monopolkapitals dürfte auch Fred Schmid nicht entgangen sein, und sie zeigt, dass sehr wohl von eigenständigen Interessen und einer eigenständigen Rolle der deutschen Bourgeoisie die Rede sein muß. Ebenso zeugt davon der Streit bei den G20-Gipfeln, auf denen Merkels Vorgehen regelmäßig der Kritik Londons, Washingtons und der Schwellenländer ausgesetzt ist.
Montag, 9. Januar 2012
Nachdenken anlässlich des 120. Jahrestags des Erfurter Programms der SPD
Von Robert Steigerwald
Ein Dialog aus Platons Werk „Der Staat“
Sokrates: Nun weißt du doch, dass die reichen Leute ganz außer Angst sind und vor ihren Sklaven sich nicht fürchten?
Glaukon: Was hätten sie auch für Veranlassung zur Furcht?
Sokrates: Keine; aber bist du dir auch klar über den Grund dieser Erscheinung?
Glaukon: Jawohl; er ist dieser: Der ganze Staat steht jedem einzelnen dieser Privatleute zur Seite.
Sokrates: Richtig. Aber gesetzt nun ein Gott entrückte einen dieser Männer, der 50 oder mehr Sklaven hat, aus der Stadt und versetzte ihn mit Weib und Kind und seiner ganzen Habe sowohl mit seinen Sklaven in eine Wüste, wo ihm kein Freier zu Hilfe kommen könnte, welche Vorstellung machst du dir da wohl von der Art und Größe der Todesfurcht für sich selbst für seine Kinder und sein Weib, in der er vor den Sklaven schwebt?
Glaukon: Sie ist die denkbar größte meiner Ansicht nach.1
Montag, 30. August 2010
Und die Staaten?
Und die Staaten?
Ein Fall von schematischer Ableitung liegt vor, wenn Veränderungen der Rolle der Nationalstaaten allein aus den TNKs und der Internationalisierung des kooperativen Arbeitsprozesses erklärt werden. So, wenn W. Listl den Nationalstaaten nur noch die Rolle zuweist, „um die günstigsten Standorte für die TNKs zu konkurrieren”. Noch deutlicher sind die „Thesen des Sekretariats”: „In der Krise verschärft sich der Konkurrenzkampf der Staaten untereinander, um dem Kapital den besten Investitionsstandort zu bieten.” (Thesen, S. 12).
Natürlich konkurrieren die Staaten auch als Standorte, aber nicht nur. Sie sind zugleich Verstärker der national basierten Monopole.Montag, 23. August 2010
Ein methodisches Problem
Statt wie Walter Listl von einem “qualitativen Sprung der Internationalisierung des Kapitals, seiner globalen Struktur” zu sprechen, macht es Sinn, von „einer neuen Stufe der Internationalisierung” zu reden, bei der es um die „Vernetzung der Produktionsprozesse und Finanzströme über den ganzen Globus” geht.
Selektiver Umgang mit den Daten über ausländische Direktinvestitionen (ADI)
Laut Walter Listl war der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen 2008 mit 16205 Mrd. US-Dollar zehnmal so hoch wie 1990. Laut UNCTAD betrug er 2087 Mrd. im Jahr 1990 und 16207 Mrd. im Jahr 2008, war also ungefähr 7,7 mal so hoch wie 1990. Doch sagen solche absoluten Zahlen wenig über eine Zunahme des Verflechtungsgrades der Volkswirtschaften aus. Das absolute Wachstum könnte einem höheren Welt-BIP zuzuschreiben sein.
Gerade um den Verflechtungsgrad geht es aber bei W. Listl, der mit seinen Zahlen einen „qualitativen Sprung der Internationalisierung des Kapitals, seiner globalen Struktur” nachweisen will. Über den Verflechtungsgrad gibt jedoch nicht die absolute Zunahme der Bestände an ausländischen Direktinvestitionen Aufschluß, sondern die Zunahme ihres Anteils am ebenfalls wachsenden BIP der Welt.
Gerade um den Verflechtungsgrad geht es aber bei W. Listl, der mit seinen Zahlen einen „qualitativen Sprung der Internationalisierung des Kapitals, seiner globalen Struktur” nachweisen will. Über den Verflechtungsgrad gibt jedoch nicht die absolute Zunahme der Bestände an ausländischen Direktinvestitionen Aufschluß, sondern die Zunahme ihres Anteils am ebenfalls wachsenden BIP der Welt.
Samstag, 24. Juli 2010
Walter Listl und der Transnationalisierungsindex
Der Transnationalisierungsindex (TNI) wurde von der UNCTAD entwickelt. Laut Walter Listl mißt er: Anteile von „Umsatz, Beschäftigten und Aktienstreuung außerhalb der Heimat der TNKs” im Verhältnis zu den entsprechenden Gesamtgrößen. Laut UNCTAD, die auch die Statistik über die internationalen Direktinvestitionen führt, mißt er Anteile von Umsatz und Beschäftigten im Ausland und das Auslandsvermögen (u.a. Filialen) der TNKs an den jeweiligen Gesamtgrößen. Der TNI enthält also keinerlei Indikator zur Aktionärsstruktur – weder zur Streuung, noch zur internationalen Verteilung. Der TNI ist daher gänzlich ungeeignet als Beleg für eine Internationalisierung des Eigentums im Sinne einer Auflösung der nationalen "Kommandohöhen" (Hilferding).
Freitag, 23. Juli 2010
Walter Listls Zahlen zu den DAX-Konzernen
"DAX-Konzerne mehrheitlich in ausländischer Hand" schrieb oft die bürgerliche Presse, aber auch das ISW. Walter Listl meint: „fast mehrheitlich”. Die Meldung verkündete zuerst das Handelsblatt vom 17.12.2007. Danach waren im Durchschnitt 52,6% der Aktien der 30 DAX-Konzerne in ausländischem Besitz. Da wurde jedoch mit der falschen Zahlenbasis gerechnet. Die Angaben treffen nur auf die frei handelbaren Aktien zu. Da können sich Prozentgrößen ergeben, die nichts über die Machtverhältnisse im Konzern aussagen. Beispiel: Die Merck KGaA ist mit ca. 70% in Clanbesitz, nur 30% der Aktien sind frei handelbar.
Donnerstag, 22. Juli 2010
DKP-Debatte in der Jungen Welt
In der Jungen Welt beginnt am 22.7.2010 eine Serie „DKP-Debatte“:
Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus und mögliche Wege zu dessen Aufhebung
Sie will mit jeweils zwei Beiträgen an 4 Donnerstagen im Juli/August unterschiedliche Meinungen aus der DKP-Debatte wiedergeben.
Teil I:
22.07.2010: "Globalisierung des Kapitals" von Walter Listl
22.07.2010: "Verstärkte Konkurrenz" von Beate Landefeld
Teil II:
29.07.2010: "Gemeinsame Alternative" von Leo Mayer
29.07.2010: "Triebkraft der Bewegung" von Männe Grüß
Teil III:
5.8.2010: "Radikal und realistisch" von Nina Hager
5.8.2010: "Die kommunistische Grundaufgabe" von Patrik Köbele
Teil IV:
12.8.2010: "Erfolgsgarantie Einheit" von Uwe Fritsch
12.8.2010: "Einheit unter Bedingungen" von Rainer Perschewski
Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus und mögliche Wege zu dessen Aufhebung
Sie will mit jeweils zwei Beiträgen an 4 Donnerstagen im Juli/August unterschiedliche Meinungen aus der DKP-Debatte wiedergeben.
Teil I:
22.07.2010: "Globalisierung des Kapitals" von Walter Listl
22.07.2010: "Verstärkte Konkurrenz" von Beate Landefeld
Teil II:
29.07.2010: "Gemeinsame Alternative" von Leo Mayer
29.07.2010: "Triebkraft der Bewegung" von Männe Grüß
Teil III:
5.8.2010: "Radikal und realistisch" von Nina Hager
5.8.2010: "Die kommunistische Grundaufgabe" von Patrik Köbele
Teil IV:
12.8.2010: "Erfolgsgarantie Einheit" von Uwe Fritsch
12.8.2010: "Einheit unter Bedingungen" von Rainer Perschewski
22.07.2010: Monopolistischer Kapitalismus
22.07.2010: Verstärkte Konkurrenz (Tageszeitung junge Welt)
Die nationale Bourgeoisie und die Staatsregierung drücken der Arbeiterklasse Standortbedingungen auf, um den globalen Wettbewerb anzuführen
Von Beate Landefeld
Das DKP-Programm enthält eine knappe Kapitalismusanalyse. Danach kam es um das Jahr 1900 herum zu einer Strukturdifferenzierung des Gesamtkapitals. Damals bildeten sich auf breiter Front markt- und produktionsbeherrrschende Konzerne, Monopole heraus und leiteten jenes Stadium des Kapitalismus ein, welches im Anschluß an Rudolf Hilferding, Lenin, Rosa Luxemburg und Nikolai Bucharin seither als Monopolkapitalismus oder Imperialismus bezeichnet wird.
Monopole entstehen durch Konzentration und Zentralisation aus der Konkurrenz und als Reaktion auf Produktivkraftentwicklung und Krisenprozesse. Sie sind eine Form der Vergesellschaftung der Produktion noch unter den Bedingungen von kapitalistischer Warenproduktion und Privateigentum. Lenin und andere Theoretiker sahen im monopolistischen Kapitalismus daher das »höchste Stadium« des Kapitalismus, das in mancher Hinsicht »Züge einer Übergangsgesellschaft« zum Sozialismus trage.
Die Vorstellung des »höchsten Stadiums« verband sich zur Zeit der Entstehung der marxistischen Imperialismustheorie mit der Erwartung einer baldigen sozialistischen Weltrevolution. Der Versuch blieb auf die Oktoberrevolution beschränkt. Manche schließen daraus, der Imperialismus sei eben doch nicht das »höchste«, sondern ein »ziemlich frühes« Stadium des Kapitalismus gewesen.
Mittwoch, 21. Juli 2010
Robert Steigerwald, Kritische Bemerkungen zu den "Thesen"
Kritische Bemerkungen zu den vom Sekretariat des Parteivorstands der DKP in der Januar - Tagung des Parteivorstands eingebrachten „Thesen“. (aus: www.kommunisten.eu)
I. Der Gang der Entwicklung.
Das Sekretariat des Parteivorstands der DKP übergab diesem „Thesen“. Sie sollten vom Parteivorstand beschlossen werden und zur Vorbereitung auf den Parteitag im Oktober 2010 dienen. Noch vor der Diskussion im Parteivorstand wurden diese Thesen bekannt. Dies durfte nicht verwundern, denn es gab und gibt im Parteivorstand als Widerspiegelung von Differenzen in der Gesamtpartei eben auch diese gewichtigen Differenzen. Mit den „Thesen“ wird von den Verfechtern der einen Richtung versucht, ihre Lesart zu Lasten der anderen festzuschreiben.
I. Der Gang der Entwicklung.
Das Sekretariat des Parteivorstands der DKP übergab diesem „Thesen“. Sie sollten vom Parteivorstand beschlossen werden und zur Vorbereitung auf den Parteitag im Oktober 2010 dienen. Noch vor der Diskussion im Parteivorstand wurden diese Thesen bekannt. Dies durfte nicht verwundern, denn es gab und gibt im Parteivorstand als Widerspiegelung von Differenzen in der Gesamtpartei eben auch diese gewichtigen Differenzen. Mit den „Thesen“ wird von den Verfechtern der einen Richtung versucht, ihre Lesart zu Lasten der anderen festzuschreiben.
Samstag, 26. Juni 2010
Stellen die Thesen uns auf neue Herausforderungen ein?
Das ist ihr Anspruch. Die ersten vier Abschnitte beschäftigen sich mit der Analyse der Krise und Auswegen daraus, mit der ökologischen Krise, mit Veränderungen in der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung.
In diesen Abschnitten findet man viel Richtiges und daneben vieles, worüber unsere Partei schon länger streitet, wie z. B. die Interpretation von Imperialismus, Neoliberalismus und Globalisierung. Oder auch die Position zu unserem Verhalten bei überregionalen Wahlen. Die Diskussion über diese bekannten Differenzen fortzusetzen, wäre schon seit Langem nötig gewesen und bleibt nötig.
Die Thesen gehen in diesem analysierenden Teil von einem bestimmten Schema von Globalisierung aus. Dieser Rahmen wird aufgefüllt mit Aussagen zum Neoliberalismus, zur Krise und zu möglichen Auswegen daraus. Dabei wird eine Reihe von Begriffen eingeführt, die nicht näher erläutert werden.
Etwa der häufig gebrauchte Begriff des „herrschenden Blocks.” So bezeichnete Antonio Gramsci bestimmte Bündnisse sozialer Klassen und Schichten, die die Macht der herrschenden Klasse stützen. Er interessierte sich für die Klassen und sozialen Kräfte, die einen „herrschenden Block” ausmachen, nicht zuletzt, um Möglichkeiten für Kräfteverschiebungen zu erkunden, mit denen Spielraum zugunsten der Arbeiterklasse entstehen kann. In den Thesen wird über die Klassenkräfte des „herrschenden Blocks” nichts gesagt. Der Begriff wird als Leerformel benutzt. Die bisher übliche Formel für „die da oben”, das „transnationale Kapital” taucht dagegen in den Thesen nur noch an einer Stelle auf. Würde der „herrschende Block” mit sozialem Inhalt gefüllt, so könnte man dies als Fortschritt sehen. Da er leer bleibt, bleibt auch die Unklarheit
Abonnieren
Posts (Atom)